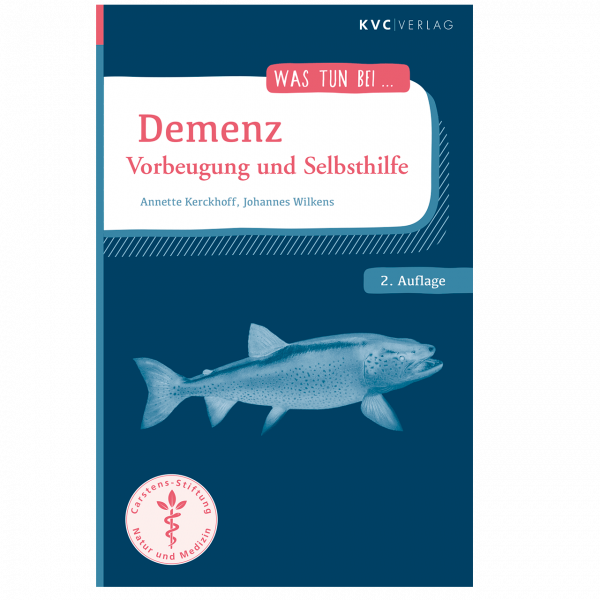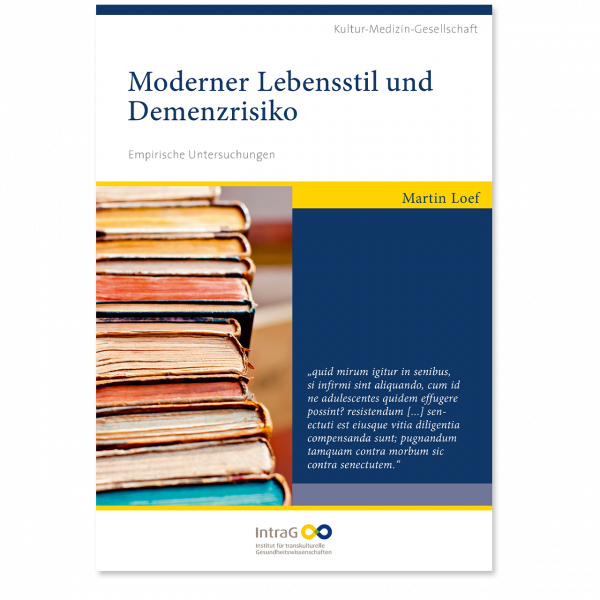Meeresfrüchte und Alzheimer: Ja oder Nein?
Fisch und andere Meeresfrüchte sind reich an neuro-protektiven Ω-3-Fettsäuren, aber enthalten oftmals auch nervenschädigendes Quecksilber. An der Rush University in Chicago wurden die Gehirne Verstorbener neuropathologisch auf Alzheimer untersucht.
Der Zusammenhang zwischen regelmäßigem Konsum von Fisch und anderen Meeresfrüchten und neuropathologischen Veränderungen im Gehirn älterer Menschen stand im Mittelpunkt einer Untersuchung des im Jahr 1997 gestarteten Memory and Aging Projekts der Universität Chicago [1]. Die zu Beginn der Studie Demenz-freien Studienteilnehmer nahmen jährlich an einer Befragung zu ihren Ernährungsgewohnheiten teil und hatten einer Autopsie ihres Gehirnes nach ihrem Ableben zugestimmt.
Demenz
Naturheilverfahren und Ordnungstherapie – Vorbeugung, Linderung von Symptomen und Steigerung der Lebensqualität
Naturheilverfahren und Ordnungstherapie – Vorbeugung, Linderung von Symptomen und Steigerung der Lebensqualität
Annette Kerckhoff · Johannes Wilkens
ISBN: 978-3-945150-95-5
Erscheinungsjahr: 2018, 2. Aufl.
6,90 EUR
Zum Shop »Die Gehirne von 203 Studienteilnehmern, die über einen Zeitraum von 10 Jahren im Alter von durchschnittlich 89,9 Jahren verstorben waren, wurden zum einen auf neuropathologische Anzeichen für eine Alzheimererkrankung (Amyloid-Plaques, Alzheimer-Fibrillen, Makro- und Mikroinfarkte, Levy-Körperchen) und zum anderen auf die Konzentration von Quecksilber und Selen in verschiedenen Hirnregionen untersucht. Diese Ergebnisse wurden mit den ausgewerteten Ernährungsbefragungen in Relation gesetzt.
Je häufiger pro Woche Fisch und Meeresfrüchte verzehrt wurden, umso höher war der Gehalt an Quecksilber und Selen in den untersuchten Hirnregionen.
Hinsichtlich der Aufnahme von Ω-3-Fettsäuren und den gemessenen neuropathologischen Parametern zeigte sich in einer ersten Analyse mit allen Teilnehmerdaten keine Korrelation.
Daraufhin wurden untersucht, ob der ε4-Status* der Probanden in Zusammenhang mit den gemessenen Parametern steht. Dies bestätigte sich für fast alle Messparameter.
ε4-positive Personen, welche mindestens einmal wöchentlich Meeresfrüchte bzw. größere Mengen langkettiger Ω-3-Fettsäuren verzehrt hatten, wiesen weniger neuropathologische Anzeichen einer Alzheimererkrankung auf als diejenigen mit einem geringeren Verzehr. Dieser Zusammenhang bestand nicht bei ε4-negativen Probanden. Zwischen dem Quecksilbergehalt und den Alzheimer-Parametern wurde kein statistisch signifikanter Zusammenhang ermittelt. Ein höherer Selengehalt war jedoch mit einer stärkeren Ausprägung von Alzheimer-Fibrillen korreliert. Eine Überprüfung dieser Ergebnisse hinsichtlich des ε4-Status zeigte keinen Einfluss.
* APOE ε4 : Apolipoprotein E ist ein wichtiges Protein im menschlichen Körper. Es gibt verschiedene genetische Ausprägungen ApoE 2, ApoE 3 oder Apo E 4. Bei Menschen mit dem Typ ApoE 4 ist die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimererkrankung höher als bei den anderen Typen.
Moderner Lebensstil und Demenzrisiko
Empirische Doktorarbeit zur Auswirkung des Lebensstils auf die Demenz
Empirische Doktorarbeit zur Auswirkung des Lebensstils auf die Demenz
Martin Loef
ISBN: 978-3-86864-031-1
Erscheinungsjahr: 2013
19,80 EUR
Zum Shop »Einschätzung
Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass mit einem einmal wöchentlichen Verzehr von Fisch oder anderen Meeresfrüchten bzw. einer regelmäßigen Aufnahme langkettiger Ω-3-Fettsäuren einer Alzheimererkrankung vorgebeugt werden kann. Allerdings ist dieser Schluss zunächst nur für alte Menschen, deren Lipidstoffwechsel im Gehirn anders verläuft als bei jungen Menschen, sowie APOE ε4-positive Personen möglich. Des Weiteren kann der Konsum anderer als der im mittleren Westen der USA zum Verzehr angebotenen Meeresfrüchte u. U. eine höhere Quecksilberbelastung und die damit verbundenen neurotoxischen Effekte nach sich ziehen. Das Gleiche gilt für einen sehr häufigen Genuss von Fisch und Co.
Literatur
Morris MC, Brockman J, Schneider JA, et al. Association of seafood consumption, brain mercury level, and APOE ε4 status with brain neuropathology in older adults. JAMA 2016; 315(5): 489-497. Abstract